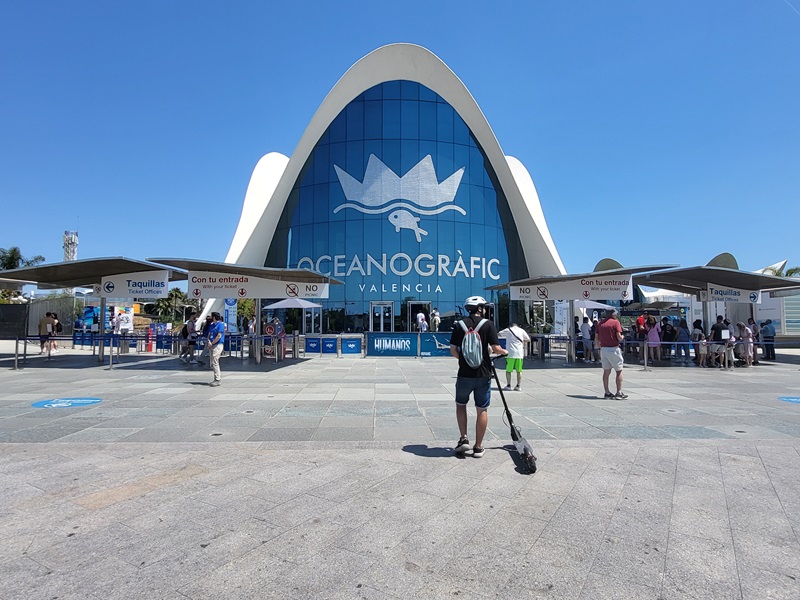Sárvár ist für ausländische Besucher vor allem eine Stadt der warmen Quellen und Thermalbäder. Da mir seit zwanzig Jahren schon physisch übel wird, wenn ich an Viktor Orban denke, habe ich versucht, Ungarn in dieser Zeit zu meiden. Wenn wir uns schließlich doch dazu entschlossen haben, das Königreich Orbáns zu besuchen, lag das an mehreren Faktoren.
Zunächst hatten wir unsere Enkelinnen zu betreuen. Das bringt die Verpflichtung mit sich, ein Programm für sie zu entwickeln. Thermalbäder sind da die erste Wahl. Nicht, dass es in Österreich nicht genügend Thermalbäder gäbe – allein in der Steiermark gibt es innerhalb einer Stunde Fahrtzeit sechs solcher Möglichkeiten –, aber genau das war das Problem.
Da Enkelin Veronika morgens sehr ungern aufsteht, war klar, dass wir keines dieser steirischen Bäder rechtzeitig erreichen würden. Um einen Parkplatz zu finden, dann einen Umkleideschrank und schließlich auch eine Liege zu ergattern, muss man nämlich um neun Uhr morgens am Eingang sein. Das ist bei unserer Enkelin völlig unrealistisch. Wir mussten einen Ort finden, der weit genug entfernt war, um sie dazu zu bringen, aufzustehen und mit uns ins Bad zu gehen, schon allein deshalb, weil die Menschen um sie herum eine unverständliche Sprache sprechen (was Ungarisch reichlich erfüllt), was sie unselbstständig macht. So besteht eine gewisse Chance, sie vor elf Uhr aus dem Bett zu holen.
Deshalb fiel die Wahl auf das ungarische Sárvár. Erst später erfuhr ich, dass die Stadt auch für Historiker wie mich äußerst interessant ist.
Sárvár ist zum Beispiel die Hauptstadt der ungarischen Reformation. Was den religiösen Glauben der Ungarn betrifft, schätze ich diese Nation sehr. Obwohl sie sich zur Reformation des kalvinistischen Typs bekannten und ihr Heerführer Stephan Bocskai sogar einen Ehrenplatz am Reformationsdenkmal in Genf hat, sind sie die einzigen Calvinisten, die ihre Küche nicht ruiniert haben. Versuchen Sie, eine lokale Spezialität in Schottland, Bremen, Amsterdam oder sogar in Genf zu genießen – es ist nirgends besonders toll. Die Ungarn haben sich diesbezüglich tapfer gezeigt und ließen sich nicht von der Gefahr einer Todsünde durch gutes Essen einschüchtern. Gulasch, Langos, Pörkölt oder Halászlé und andere Köstlichkeiten haben sie sich nicht nehmen lassen. Das macht Ungarn trotz Viktors Eskapaden zu einem recht attraktiven Reiseziel.
Es war jedoch Sárvár, auch „das ungarische Wittenberg“ genannt, wo der ungarische Humanist János Sylvester tätig war, der hier 1539 das Buch „Grammatica hungarolatina“ herausgab, das nicht nur das erste Buch in ungarischer Sprache war, sondern im Grunde die Grundlagen der ungarischen Sprache legte (die Amtssprache in Ungarn war bis ins 18. Jahrhundert Latein). Danach folgte der nächste logische Schritt. Wie Luther in Deutschland, übersetzte auch Sylvester das Neue Testament ins Ungarische (1541). Im Schlosspark ist ihm eine Bank gewidmet.

Es wäre schön, sich vorzustellen, dass Sylvester gerade auf dieser Bank die ungarische Schriftsprache entwickelte, aber dem war nicht so. Die Burg von Nádasdy war bis 1810 von einem 30 Meter breiten Wassergraben umgeben, und erst dann beschloss der neue Besitzer Franz d´Este, aus der Festung einen angenehmen Wohnort zu machen. Der Graben wurde zugeschüttet, und später entstand dort der Park und die Bank noch viel später. Die meisten Bäume in diesem Park wurden etwa hundert Jahre später, in den 1930er Jahren, gepflanzt, und sie sind mittlerweile zu einer imposanten Größe herangewachsen. Sylvesters religiöse Orientierung ist mir etwas rätselhaft. Er war ein Schüler Melanchthons, also der rechten Hand von Martin Luther, sodass er noch keine Verbindung zu Calvin haben konnte. Ein anderer Gelehrter, Mátyás Bíró Dévay, veröffentlichte bereits 1538, also ein Jahr vor Sylvesters ungarischer Grammatik und somit vor der Entstehung der offiziellen ungarischen Schriftsprache, den ersten ungarischen Katechismus in Sárvár – die beiden Herren müssen eng zusammengearbeitet haben. Daher hat Sárvár seinen Titel als „Stadt der ungarischen Reformation“ erhalten.
Dennoch ist offensichtlich die Mehrheit der Einwohner von Sárvár katholisch.

Mindestens zwei große katholische Kirchen gibt es hier: die Kirche des heiligen Ladislaus am Kossuth-Platz und die Kirche des heiligen Michael. Die evangelische Kirche ist relativ klein und soll den Kampf von Franz II. Rákóczi für Religionsfreiheit symbolisieren. Nach Rákóczi ist auch die Hauptstraße benannt, die zu den Thermalbädern führt.

Ein weiteres Denkmal im Park um das Schloss ist dem Dichter der ungarischen Renaissance Sebestyén Lántos Tinódi gewidmet, der 1556 in Sárvár starb. Es gibt nicht viele Dichter, die sich einen Adelsstand ersungen haben. Tinódi hat es geschafft. Am 23. August 1553 wurde er auf Empfehlung des Palatins Tamás Nádasdy von König Ferdinand I. in den Adelsstand erhoben. Sein länglich geteiltes Wappen zeigt ein Schwert im roten und eine silberne Laute im blauen Feld.

Das letzte Denkmal im Park ist den Opfern des Holocausts gewidmet. In Sárvár lebten etwa 500 Juden. Sie waren gut integriert, und das Horthy-Regime schützte sie bis 1944. Doch im März 1944 besetzten die Deutschen Ungarn. Im Mai 1944 wurde in Sárvár ein jüdisches Ghetto errichtet, und im Juli begannen die Transporte, hauptsächlich in das Konzentrationslager Auschwitz. Nur wenige Juden aus Sárvár überlebten den Krieg, und selbst diese kehrten nicht nach Sárvár zurück. Die jüdische Gemeinde in dieser Stadt erlosch somit im Jahr 1944, und nur das Denkmal im Park unter den Festungsmauern erinnert an sie.

An der Fassade der Kirche des heiligen Ladislaus erinnert eine Gedenktafel daran, dass hier zwischen 1939 und 1941 polnische Flüchtlinge, vor allem Soldaten, für die Freiheit ihres Landes und den Ruhm Ungarns beteten. 1941 trat Horthys Ungarn dann an der Seite des nationalsozialistischen Deutschlands in den Krieg ein, und der Ruhm war dahin. Die Ungarn haben eine unfehlbare Neigung, immer auf der Seite der Verlierer zu kämpfen. Hoffen wir, dass sie diese Tradition auch heutzutage fortsetzen, da sich Orbán eindeutig auf die Seite des russischen Aggressors stellt. Vor der Kirche stehen die Büsten der Nationalhelden Sándor Petöfi und Lajos Batthyány, die beide ihr Leben in der Revolution von 1848 ließen. Petöfi fiel im Kampf gegen die Russen bei Világos, und Ministerpräsident Batthyány wurde 1849 nach Niederschlagung des Aufstandes von den Österreichern hingerichtet – obwohl er an dem Aufstand gar nicht teilgenommen hatte.
Das Rathaus am Kossuth-Platz hat über dem Eingang ein Glockenspiel.

Ich weiß nicht, wie oft es spielt, aber ich habe es um vier Uhr nachmittags gehört. Ich habe die künstliche Intelligenz gefragt und festgestellt, dass sie keine Ahnung hat. Sie behauptete, das Glockenspiel spiele um elf Uhr morgens und um sechs Uhr abends. Was sie nicht weiß, denkt sich dieser Schlaumeier einfach aus. Auf dem Platz gibt es auch ein Denkmal für die ungarischen Husaren aus Sárvár, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Die Liste der Gefallenen auf den Tafeln, die an den Wänden der Kirche des heiligen Ladislaus befestigt sind, ist erschreckend lang. Die Angriffe der Kavallerie in Zeiten von Stacheldraht und Maschinengewehren waren offensichtlich selbstmörderische Missionen.
Die Stadt wird von einer großen Burg dominiert, die den Namen der berühmtesten Familie trägt, die hier residierte und die die Burg bauen ließ – der Familie Nádasdy.

Die heutige Burg wurde um 1560 von Palatin Tamás Nádasdy als Renaissancefestung erbaut – das war notwendig, da die Stadt am Fluss Raab an der Frontlinie in den ständigen Kämpfen mit den Türken lag. Tamás’ Enkel Ferenc Nádasdy wurde auch aus diesem Grund zu einem berühmten ungarischen Kämpfer gegen die türkische Bedrohung. Ursprünglich stand hier offenbar eine Wasserburg, umgeben von Sümpfen, die eine natürliche Verteidigung darstellten. Sárvár bedeutet übersetzt „Lehmburg“. Obwohl die Burg später in barockem Stil umgebaut wurde, behielt sie ihren Namen. 1803 kaufte der habsburgische Herzog Franz IV. d’Este, Herzog von Modena und Reggio, die Burg. Er war es, der die Festung zu einem Lustschloss umbaute, den Wassergraben zuschütten ließ und den heutigen imposanten Park anlegte. 1875 ging die Burg an die bayerische Königsfamilie Wittelsbach über, da der Sohn des Prinzregenten Luitpold, Ludwig, mit Prinzessin Maria Theresia Dorothea d’Este verheiratet war und so kam das Anwesen von Sárvár in seinen Besitz. Das Schicksal wollte, dass Ludwig III. gerade hier, bereits als König, starb. Ludwig übernahm nach dem Tod seines Vaters 1912 die Regentschaft für den unfähigen König Otto. Im Jahr 1913 verloren die Bayern endgültig die Geduld, änderten die Verfassung und riefen Ludwig zum König aus, ohne Otto den Titel zu entziehen, sodass Bayern bis zu Ottos Tod 1916 zwei Könige hatte. Ludwig war beim Volk, wie sein Vater, sehr beliebt. Sein Hobby war die Landwirtschaft, und er führte einen großen Bauernhof nach modernen Methoden, wobei auf die Hygiene der Tiere geachtet wurde, sodass er bei den Bayern den liebevollen Spitznamen „Milchkönig“ erhielt. Leider brach bereits ein Jahr nach seiner Thronbesteigung der Erste Weltkrieg aus, der seine Reformpläne unterbrach, da Bayern als Teil des Deutschen Kaiserreichs gezwungen war, an der Seite der herrschenden Preußen in den Krieg zu ziehen. Aus dem geliebten König wurde dadurch ein gehasster, und am 7. November 1918 zwangen ihn Revolutionäre unter der Führung von Kurt Eisner zur Abdankung und riefen den „Freistaat Bayern“ aus. Da Ludwig keinen Widerstand leistete, durfte er sich auch später in Bayern aufhalten, starb jedoch am 21. Oktober 1921 in seiner ungarischen Residenz Sárvár. Die Nádasdy-Burg diente noch seinem Enkel, Ludwig Karl Maria, als Zuflucht vor der immer stärkeren Schikane der Nazis. (Sein Onkel, der Kronprinz Rupprecht, versteckte sich als Gegner der Nazis in Italien, seine Familie landete sogar in Konzentrationslagern.) Die Wittelsbacher betrieben in Sárvár eine Pferdezucht, und Ludwig Karl Maria gelang 1945 ein wahrer Husarenstreich, als er seine edlen Pferde durch die russischen Linien bis nach Deutschland brachte.

Der bereits erwähnte Enkel des Burgenbauers Ferenc Nádasdy ist in unseren Breitengraden aus zwei Gründen bekannt. Erstens war er unter dem Spitznamen „Schwarzer Beg“ ein Schrecken für die Türken und erfolgreich bei der Eroberung der Festungen Esztergom, Visegrád, Székesfehérvár und Vác. Es wird ihm auch die Eroberung von Győr (Raab) zugeschrieben, aber meine Leser wissen, dass dort der Vorfahre des ehemaligen tschechischen Außenministers Karl Schwarzenberg, Adolf, sowie Graf Miklós Pálffy durch Eroberung dieser Stadt berühmt wurden. Allerdings gelang es den Türken zu Lebzeiten Nádasdys nicht, eine einzige der von ihm eingenommenen Städte zurückzuerobern. Damals führte der Kaiser mit dem Sultan von 1593 bis 1606 den sogenannten „Langen Krieg“, der beide Seiten finanziell und moralisch ruinierte. Nádasdy war seit 1587 Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres und seit 1594 Mitglied des „Kriegsrats“, 1598 wurde er zum Ritter geschlagen. Bemerkenswerterweise starb er – was für einen Feldherrn seiner Zeit ungewöhnlich war – im Bett, an einer Krankheit im Januar 1604.
Der zweite Grund für seine Bekanntheit war seine Ehe. Er war nämlich mit Erszébet (auf Deutsch Elisabeth) Báthory, bekannt als die „Blutgräfin“, verheiratet. Die Gräfin Elisabeth war keine gewöhnliche Person. Ihr Onkel Stephan Báthory war König von Polen, ihr Bruder, ebenfalls Stephan, war der Erzieher von Gabriel Báthory, der 1606 Fürst von Siebenbürgen wurde. Die Familie Báthory gehörte also zur höchsten Gesellschaft und vor allem – sie war außerordentlich reich. Franz und Elisabeth hatten zusammen fünf Kinder, von denen jedoch zwei im Kindesalter starben. Elisabeth lebte neben der slowakischen Burg Čachtice und Wien auch in Sárvár. Der Ort ihrer Verbrechen, wo sie angeblich junge Jungfrauen ermorden ließ, um in deren Blut zu baden und so ewig jung zu bleiben, befindet sich in Wien in der Augustinergasse 12, wo Nádasdy als wichtiger kaiserlicher Beamter, seinen Palast hatte. Der Skandal brach 1610 mit der Aufdeckung ihrer Morde aus und erschütterte das gesamte Kaiserreich.
Bis heute streiten sich Historiker darüber, ob Elisabeth wirklich eine blutrünstige Sadistin war oder ob alles nur eine Intrige des ehrgeizigen Palatins György Thurzó war. Elisabeth Báthory war nämlich außerordentlich reich und führte sich nach dem Tod ihres Mannes wie das Oberhaupt der Familie auf, was für eine Frau zu jener Zeit absolut ungewöhnlich und provokativ war. Während Elisabeth zur traditionellen ungarischen Hochadelsgesellschaft gehörte, war Thurzó ein Emporkömmling, dessen Vorfahren erst im 16. Jahrhundert durch die Zusammenarbeit mit der Augsburger Familie Fugger und damit erworbenen Reichtum in den Adelsstand erhoben worden waren. Am 29. Dezember 1610 stürmte Palatin Thurzó mit seinen Soldaten die Burg in Čachtice und ließ sie durchsuchen. Dabei wurden angeblich Leichen junger Mädchen entdeckt. Der darauffolgende Prozess (eigentlich zwei, da einer auf Latein und der andere auf Ungarisch geführt wurde) waren sehr fragwürdig. Schon allein deshalb, weil Elisabeth an diesem Prozess nicht einmal teilnehmen durfte, sondern in Abwesenheit allein auf Grundlage der Aussagen ihres Dienstpersonals verurteilt wurde, die unter Folter erpresst worden waren. Drei der vier Zeugen wurden nach der Folter lebendig verbrannt. Thurzó lehnte das Ersuchen des Kaisers Matthias ab, Elisabeth hinzurichten, und verurteilte sie stattdessen zu lebenslangem Hausarrest auf der Burg Čachtice, wo sie vier Jahre später starb. Ob sie wirklich lebendig eingemauert wurde, wie es der slowakische Regisseur Jakubisko in seinem Film „Báthory“ darstellte, ist sehr zweifelhaft. Mindestens konnte sie während ihrer Haft Kontakt zu ihren Kindern halten und sogar über Erbschaftsangelegenheiten entscheiden.
Was kann man also im Schloss von Sárvár sehen? Es gibt dort ein Museum mit einer Ausstellung über die Geschichte der Husaren, ein Museum für angewandte Kunst, man kann den repräsentativen Saal des Schlosses besichtigen und es gibt eine Sammlung historischer Karten Ungarns.

Der Park auf dem ehemaligen Burggraben ist jedoch nicht die einzige Grünfläche in der Stadt. Der Hauptpark ist das Arboretum, das nur wenige Dutzend Meter vom Schloss auf der anderen Seite der Hauptstraße entfernt liegt.

Das Arboretum, also der botanische Garten in Sárvár, wurde bereits zur Zeit von Ferdinand I., also im 16. Jahrhundert, gegründet. Seitdem hat sich dort viel Interessantes angesammelt. Es gibt seltene und exotische Bäume, gigantische Platanen und Ginkgo-Bäume, Blumenbeete und Pflanzen, die die lokale Flora repräsentieren, Teiche und Seen mit Wasserpflanzen und Tieren. Leider blühte im August, als ich dort war, nichts – abgesehen von einem rosa Busch mit zwei Blüten. Aber für den Eintrittspreis eines Euros und zwanzig Cent war es trotzdem ein schöner Spaziergang.
Das Zentrum des Geschehens in Sárvár ist natürlich das Thermalbad.

Die warmen Quellen, die hier an die Erdoberfläche sprudeln, sollen heilend sein und angeblich so ziemlich alles heilen. Im Jahr 2012 wurde Sárvár nach Durchführung von Zertifizierungstests vom ungarischen Hauptgesundheitsamt offiziell zum Kurort erklärt. Dies haben vor allem tschechische Besucher entdeckt, von denen es hier viele gibt. Ich vermute jedoch, dass der Hauptgrund weniger die heilende Wirkung des Wassers, sondern eher die Tatsache, dass der Eintritt relativ günstig ist – deutlich günstiger als in den Thermen in Österreich. Ein Tagesticket kostet 7.900 Forint, was etwa 20 Euro entspricht. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet in der Hauptsaison 48 Euro pro Tag. Außerhalb der Hauptsaison – also auch jetzt in November – sind die Preise noch günstiger (16 bzw. 40 Euro). Alles ist neben Ungarisch, Deutsch und Englisch auch auf Tschechisch beschrieben.
In den Pools gibt es viele Attraktionen für Kinder: Rutschen, ein Piratenbecken und ein Wellenbecken. Kleine Rutschen gibt es im „Family Spa“ unter dem Dach, draußen im Gelände finden sich große Rutschen in verschiedenen Neigungen und Formen, wobei ich hier keine „Killer“-Rutschen wie in Moravske Toplice gesehen habe.
Übrigens, das Personal spricht Deutsch und zumindest grundlegendes Tschechisch, sowohl an der Kasse als auch in den Restaurants, sodass man Ungarisch nicht benötigt und selbst diejenigen zurechtkommen, die außer der Muttersprache keine andere Sprache beherrschen. Die Beschreibungen der Speisen auf Deutsch und Tschechisch wurden zwar offensichtlich von Ungarn eigenhändig erstellt und haben manchmal ein Lächeln zur Folge, sind aber verständlich. Und falls Ungarn auf den Anzeigetafeln Slowakisch mit Slowenisch verwechseln, ist das nichts, was einen Touristen aus der Ruhe bringen würde.

Lángos bleibt Lángos, Gulyás ist Gulasch und dass Suppe „leves“ heißt, ist nicht schwer zu verstehen. Eine Konditorei zu finden („cukrázda“) ist ebenfalls machbar für einen ausländischen Touristen, „kavézó“ bedeutet Kaffeehaus, nur bei „étterem“ – also Restaurant – könnte ein Tourist kurzfristig Schwierigkeiten haben. Aber satt wird man auf jeden Fall. In Sárvár gibt es fast so viele Restaurants wie Hotels und Apartments, also reichlich Auswahl.
Auch das Bierangebot hat sich offensichtlich den Besuchern angepasst. Hier bekommt man eine Menge tschechischen Biermarken, wie Krušovice, Budvar, Staropramen oder Pilsner Urquell.
Ein Nachteil ist, dass man in den Restaurants im Thermenbereich nicht mit den Armbändern zahlen kann, die man beim Eintritt, wie in Österreich, erhält. Man muss Bargeld oder eine Bankkarte mitnehmen, was natürlich Taschendiebe anzieht. Meiner Frau wurden während unseres Aufenthalts im warmen Wasser die Armbanduhr gestohlen. Mit Karte zu zahlen ist zwar bequem, aber leider teuer. Während der offizielle Wechselkurs bei 396 Forint pro Euro lag, wurde in den Thermen ein Kurs von 360 berechnet, was bei jeder Kartenzahlung automatisch einen Aufschlag von 10 Prozent bedeutet. Es ist also günstiger, Bargeld am Geldautomaten in der Stadt abzuheben (zu einem akzeptablen Kurs von 391:1) und bar zu bezahlen.