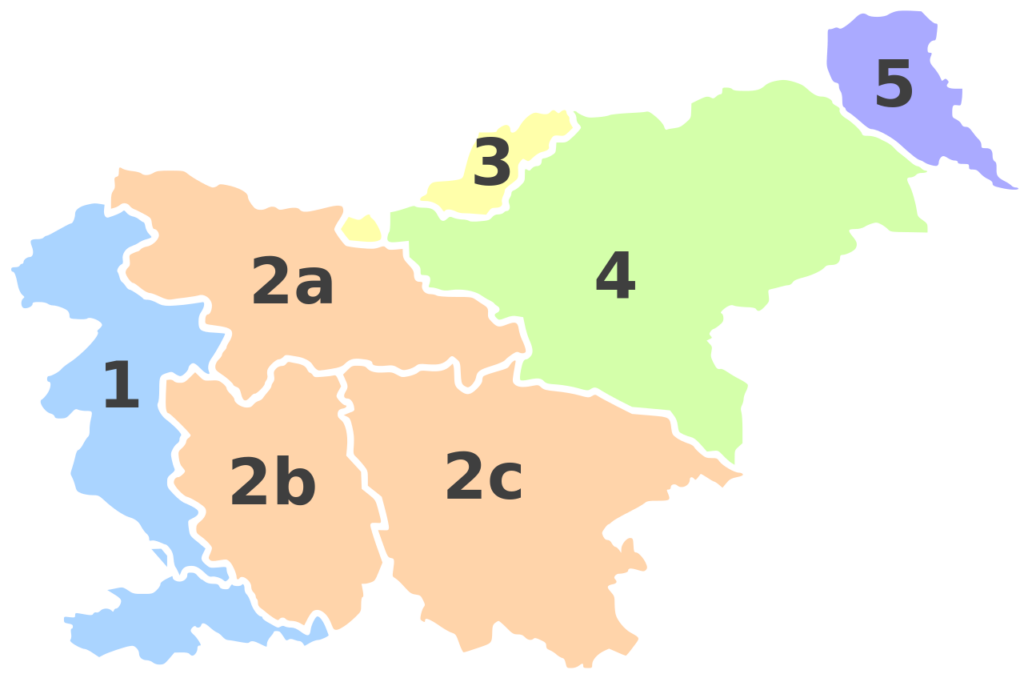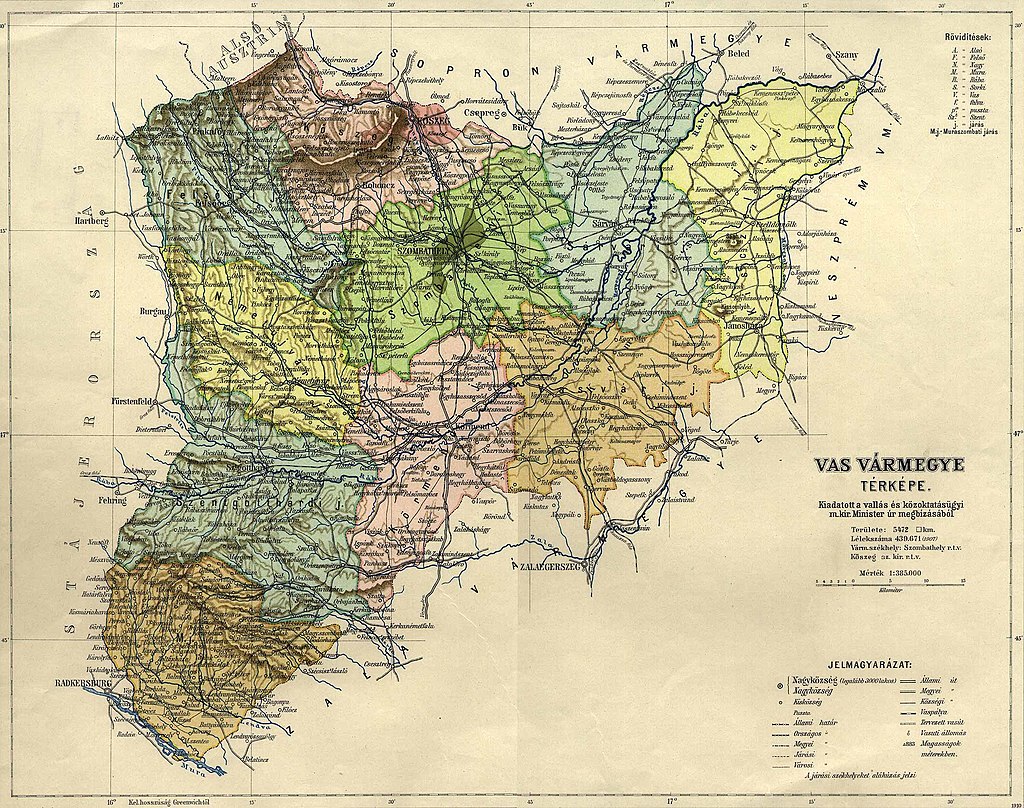“Lübeck ist weltbekannt für sein Marzipan”, sagte einmal eine Schulkollegin meines Sohnes die aus dieser Stadt stammte, fügte aber gleich deprimiert hinzu: “Aber davon wissen nur die Lübecker selbst.” Die Legende, dass Marzipan gerade in dieser Stadt erfunden wurde, als die Bürger während einer Belagerung und drohenden Hungersnot ein paar Säcke Zucker und Mandeln fanden, ist natürlich erfunden. Marzipan stammt aus dem Orient und gelangte – wie könnte es anders sein – über Venedig nach Europa. Aber in Lübeck trifft man an jeder Ecke darauf, es gibt ganze Geschäfte mit Marzipan und es werden daraus nicht nur Statuen in allen möglichen Größen, sondern sogar Trabbis hergestellt. Zwar nicht fahrbar, dafür umso süßer.

Lübeck war vor allem eine Handelsstadt und über seinen Hafen gelangte die süße Versuchung, die im frühen 16. Jahrhundert als Aphrodisiakum galt, also so etwas wie das Viagra der damaligen Zeit, in ganz Norddeutschland. Das absolute Mekka für Marzipanliebhaber ist das Cafe Niederegger – wo sonst als in Lübeck, auf einem ehrenwerten Platz neben dem Rathaus. Hier gibt es auch ein Marzipanmuseum, falls Sie nach einem Spaziergang durch die Stadt noch nicht genug davon haben. Wenn in den Museen von Madam Tussaud die Portraits der Prominenten aus Wachs gemacht werden, hier kann man zum Beispiel Thomas Mann aus Marzipan bestaunen. Aber wir sind nicht wegen des Marzipans in diese Stadt im Norden Deutschlands gefahren. Genauso wie die überwiegende Mehrheit der Menschen auf der Welt hatten wir keine Ahnung von seinem Ruhm. Aber Lübeck hat noch viel mehr zu bieten.
Das Holstentor, als architektonische Kuriosität, brachte es im Jahr 2006 auf eine der ersten deutschen Gedenk-Zwei-Euro-Münzen.

Die Stadt hatte enge Beziehungen zu einem deutschen Kanzler und gleich zwei Trägern des Nobelpreises für Literatur. Willi Brandt wurde hier im Jahr 1913 und Thomas Mann im Jahr 1875 geboren und Günter Grass starb hier im Jahr 2015. Es gab also viel zu entdecken.
Lübeck liegt am Fluss Trave nahe der Nordsee. Praktisch alle wichtigen Häfen in Nordeuropa liegen im Landesinneren an Flüssen, da die raue Witterung den Bau von sicheren Häfen direkt an der Küste erschwert (eine Ausnahme ist beispielsweise Tallinn in Estland). Obwohl die Trave kein großer Fluss ist, entschied sich Graf Adolf II. von Schauenburg im Jahr 1143, auf einer Insel zwischen den Flüssen Trave und Wakenitz eine Stadt zu gründen. Für die damaligen Schiffe reichte die Trave aus, heute müssen große Schiffe, die in Travemünde anlegen, zurück ins Meer rückwärtsfahren, weil sie im Hafen nicht genug Platz zum Umdrehen haben.
Nachdem die erste Stadt bereits im Jahr 1157 niedergebrannt war, gab Graf Adolf den Platz an Herzog Heinrich den Löwen von der Herzogfamilie der Welfen ab. Dieser ließ die Stadt ausbauen, aber die Welfen wagten es, sich mit der regierenden Dynastie der Staufer anzulegen. Heinrich der Löwe verlor Bayern in einem Kampf mit Friedrich Barbarossa. Barbarossas Enkelsohn Friedrich II., verlieh dann Lübeck im Jahr 1226 mitten in Welf-Sachsen den Status einer freien Reichsstadt. Die Welfen mussten auf die geplanten Erträge aus der reichen Stadt verzichten, heute würde man es eine schlechte Investition nennen.
Die Lübecker waren ungewöhnlich unternehmungslustig. Es war nicht nur Marzipan und Wein, an denen sich die lokalen Kaufleute und die Stadtkasse eine goldene Nase verdienten. In Lübeck wurde ein neuer Typ von Handelsschiff, die sogenannte Kogge, erfunden, die bis zu 300 Tonnen Fracht aufnehmen konnte. Lübeck galt als “Königin der Hanse”, hatte Handelsniederlassungen von London bis Novgorod und war 1370 nach Köln die zweitgrößte deutsche Stadt. Damals entstanden wunderschöne Gebäude, auf die die Stadt noch heute stolz ist. Lübeck wagte sogar einen Krieg mit seinem unmittelbaren mächtigen Nachbarn – dem Königreich Dänemark, das ihm in der Nordsee Konkurrenz machte. Es ging um die Kontrolle der strategisch wichtigen Meerengen zwischen der Ostsee und der Nordsee, Skagerrak und Kattegat, die für den Lübecker Handel lebenswichtig waren. (Dänemark kontrollierte zu dieser Zeit auch das Gebiet um Lund und Malmö auf der Skandinavischen Halbinsel.) Im Krieg von 1534-1536 gelang es der von Lübeck geführten Koalition sogar, Kopenhagen zu erobern. Aber gerade mit diesem Krieg gegen den mächtigen Nachbarn überspannten die Bürgen von Lübeck ihre Kräfte, was den Niedergang der Stadt zur Folge hatte. Seine Truppen mussten sich 1536 in Kopenhagen ergeben und seine Flotte erlitt eine vernichtende Niederlage auf See. Die Machtposition der Stadt im Norden war damit dahin. Gerade aus der Zeit der Belagerung der Stadt durch dänische Truppen stammt der größte Münzschatz, der jemals in Deutschland gefunden wurde. Beim Ausheben von Fundamenten für eine neue Hochschule für Musik entdeckte ein Baggerfahrer einen Schatz von 395 Gold- und 23.228 Silbermünzen, den jemand aus Angst vor der dänischen Plünderung vergraben und nicht wieder ausgegraben hatte – obwohl die Dänen die Stadt schließlich nicht eroberten. Wir konnten diesen Schatz bei unserem Besuch im Stadtmuseum bewundern. Der Abstieg des Reichtums und der Bedeutung Lübecks setzte sich fort, nach dem Zerfall der Hanse und dem Dreißigjährigen Krieg sank die Bedeutung der Stadt (obwohl sie aufgrund ihrer Befestigungen nie erobert wurde). Heute hat die Stadt etwa eine Viertelmillion Einwohner und gehört damit in Deutschland eher zu den kleineren regionalen Zentren.
Die Schicksalsstunde schlug in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942, an einem Palmsonntag, als 234 britische Bomber die Stadt angriffen. Das Ergebnis war verheerend. 300 Menschen starben, 1.468 Häuser wurden zerstört und die Glocke der Marienkirche stürzte vom Turm, und ihre Trümmer sind noch heute zu sehen.

Lübeck hatte jedoch Glück im Unglück. Der Schweizer Diplomat und Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Carl Jacob Burckhardt, erlebte die Beinahe-Zerstörung der Stadt und es gelang ihm, den Verbindungsoffizier der Alliierten, Eric Warburg, zu überzeugen, in Lübeck einen Umschlagplatz für das Material des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zu errichten. Dies rettete die Stadt vor weiteren verheerenden Angriffen, denen andere deutschen Städte wie Hamburg, Bremen, Nürnberg oder Dresden zum Opfer fielen.
Der Angriff forderte auch vier Lübecker Märtyrer. Der lutherische Pastor Karl Friedrich Stellbrink hatte unmittelbar nach dem Angriff am Palmsonntag, als die Stadt noch brannte, eine Predigt gehalten, in der er rief: “Gott hat jetzt mit mächtiger Stimme gesprochen, um die Menschen zu lehren, wieder zu beten.” Die Gestapo interpretierte dies als Zustimmung zum Angriff. Der Pastor und drei katholische Geistliche, die sich ihm angeschlossen hatten, wurden verhaftet, durch ein Standgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. 2011 wurden sie von Papst Benedikt XVI. seliggesprochen. Ein Museum, das sich mit ihnen und dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten befasst, befindet sich in der evangelischen Lutherkirche, und eine Gedenktafel an der Seitenwand des Rathauses erinnert an sie.

Nach dem Krieg hatte Lübeck zwar Glück, in die britische Besatzungszone zu kommen, aber es wurde zu einer Grenzstadt – die Grenze zwischen der russischen und der britischen Zone und später zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik verlief auf dem Fluss Trave. Dies trug nicht gerade zur Attraktivität der Stadt bei, zusätzlich kamen 90.000 Flüchtlinge aus dem östlichen Europa hierher. Der Eiserne Vorhang fiel also direkt vor den Toren der Stadt. Zum Glück für Lübeck jedoch nicht hinter seinen Toren. Dank dieser Tatsache konnte die teilzerstörte Stadt wiederhergestellt werden, obwohl die Rekonstruktionsarbeiten bis in die 1980er Jahre dauerten. Heute ragen wieder schlanke grüne Kirchtürme in den Himmel und die Stadt erstrahlt in ihrer früheren Pracht.
Das Wahrzeichen der Stadt und des gesamten Bundeslandes Schleswig-Holstein ist jedoch das Holstentor. Es ist das Stadttor auf einer Insel zwischen dem Stadtgraben und der Trave. Ihr Bild zierte bis 1990 die Rückseite des 50-Mark-Scheins und heute ist es auf der Gedenkmünze von 2006 zu sehen – es war die erste Münze mit Motiven der einzelnen Bundesländer. Dieses Tor mit zwei spitzen Türmen, die ein wenig schief stehen, weil der Untergrund sumpfig ist, stammt aus dem Jahr 1478. Am Tor befindet sich das Holstentormuseum mit einer Ausstellung über die Hanse, dort können Waren besichtigt werden, die Wohlstand in die Stadt brachten. In der Nähe kann man dann die ehemaligen neu rekonstruierten Salzspeicher sehen. Das Geschäft mit Salz war im Mittelalter sehr attraktiv.
Wenn man nicht nur das Holstentor, sondern auch die gesamte Stadt von oben sehen möchte, muss man auf den Turm der St.-Petri-Kirche steigen. Wenn man sich damit abfindet, dass die Fenster vergittert sind. Der Innenraum der Kirche ist leer, es gibt hier nur ein schwarz-weißes Kreuz, da die Kirche bei dem Bombenangriff zerstört und erst 1987 wieder aufgebaut wurde.

Ein paar Schritte entfernt befindet sich der Hauptplatz “Markt” mit dem prächtigen Gebäude des Rathauses. Das erste Rathaus durften die Bürger bereits im Jahr 1230 errichten, das heutige Gebäude stammt jedoch aus dem Jahr 1435. Nicht aber das ganze Gebäude, nur der weiß leuchtende Teil mit den Wappen der Hansestädte und der Lübecker Patriziern. Im rechten Winkel dazu befindet sich das sogenannte “Neue Gemach”. An seiner Fassade wechseln sich kaiserliche Adler mit dem Wappen von Lübeck ab – horizontal gespaltener Wappen in Rot und Silber.

Wir haben das Rathaus natürlich besucht, beim Verkauf der Tickets erlebte ich allerdings einen Schock, von dem ich mich bis heute nicht ganz erholt habe. Die Dame an der Kasse fragte, ob wir Tickets für Erwachsene wollten. Sie bemerkte meinen verwirrten Blick und fragte, ob ich vielleicht eine Rentnerermäßigung hätte. Ich füge hinzu, dass ich damals 48 Jahre alt war. Ich kaufte mir ein Ticket zum vollen Preis, der Stolz siegte über die Gier.
Im Rathaus kann der Audienzsaal besichtigt werden, in dem Thomas Mann und Willy Brand die Ehrenbürgerschaft der Stadt erhielten, der Sitzungssaal des Stadtparlaments und der Gerichtssaal. Interessant sind die Türen zum Gerichtssaal, genauer gesagt aus ihm heraus. Sie haben unterschiedliche Höhen. Wenn jemand schuldig befunden und verurteilt wurde, musste er durch die kleine Tür gehen, in denen er sich bücken musste. Wer von Schuld freigesprochen wurde, konnte durch die große Tür mit erhobenem Haupt gehen. Oder, wie es die Einheimischen gleich witzig beschrieben haben: “Kleine Sünder durch die kleine Tür, große Sünder durch die große Tür.” Offensichtlich hat sich an dieser Regel bis heute nichts geändert.

Vor dem Rathaus steht auf dem freien Platz am Markt der sogenannte “Kaak”, ein offenes niedriges Gebäude mit einem Kupferdach. Im Erdgeschoss gab es einen Markt und oben in einem offenen Turm wurden verurteilte Verbrecher ausgestellt, es war also eine Art Pranger – ziemlich menschlich im Gegensatz zu anderen Prangern befand sich der Verurteilte außerhalb der Reichweite einer boshaften Menge.